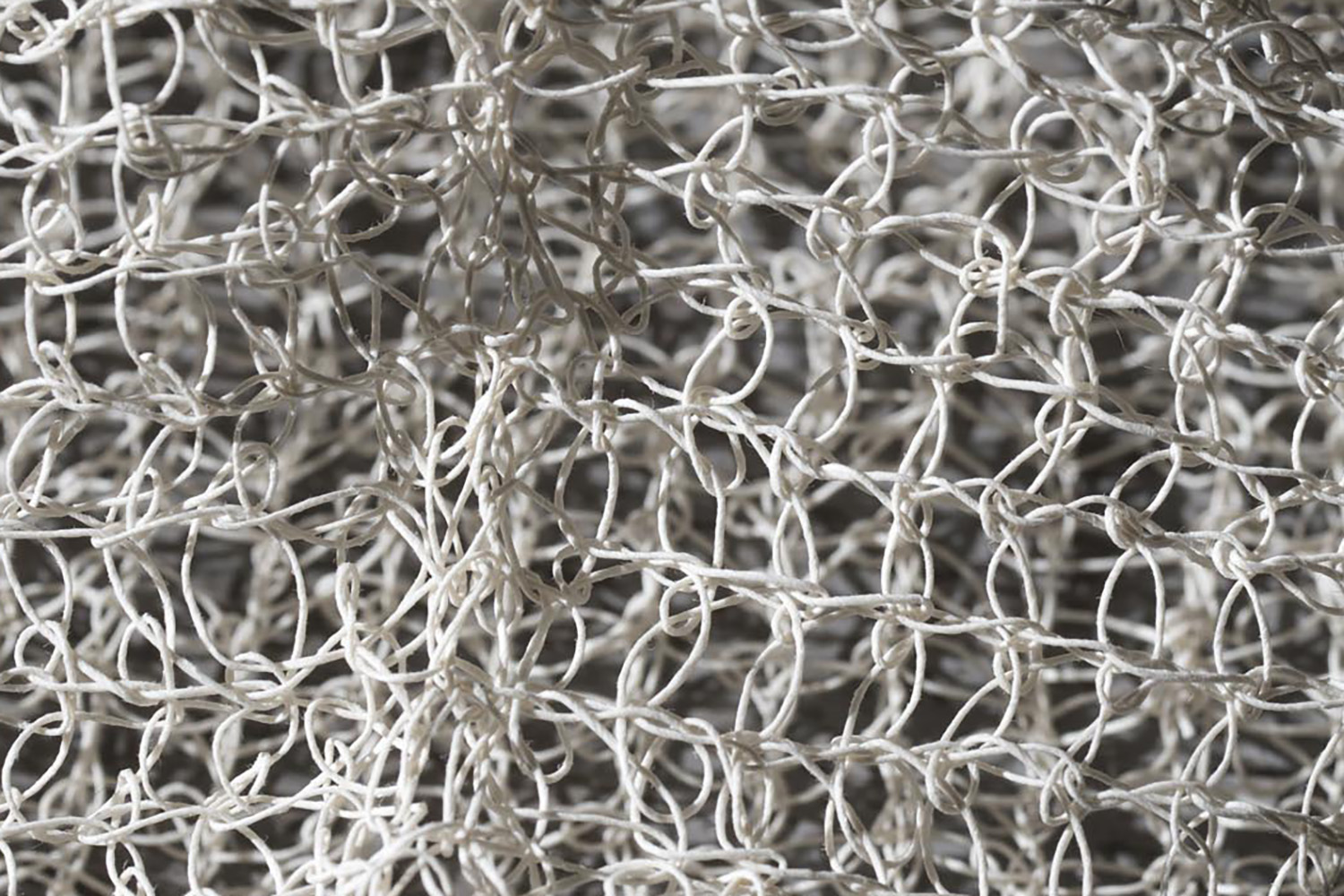Wenn wir uns im Spiegel betrachten, sehen wir ein Bild von uns. Doch das sind nicht wir selbst. Es mag uns daran erinnern, dass zwischen dem Bild von uns und dem wahren Selbst ein Unterschied existiert – ein wesentlicher sogar! Es ist oft ein lebenslanger Prozess von der Vorstellung dessen, wer wir meinen, dass wir sind zu dem zu gelangen, wer wir wirklich sind.

Jeder Mensch hat ein Selbstbild von sich. Es könnte etwa so lauten: „Ich bin hilfsbereit, freundlich, klug, attraktiv und sage offen, was ich denke. Außerdem bin ich unmusikalisch, schlampig, unverlässlich und tolpatschig.“ Woher formt sich nun ein solches Selbstbild, denn wenn wir auf die Welt kommen, kann man das wohl noch nicht von einer Person wissen? Ab dem Zeitpunkt der Geburt erfahren wir uns im Spiegel der engsten Bezugspersonen. Sind diese einfühlsam für die Bedürfnisse des Säuglings, aufmerksam und zugewandt, so lernt der kleine Mensch, dass er wichtig ist und geliebt wird. Es entwickelt sich ein Urvertrauen, das in dieser Phase ganzkörperlich erfahren wird durch die angenehmen Empfindungen, die Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Angenommensein etc. auslösen. Ist es den Erwachsenen aus welchen Gründen auch immer nicht möglich, sich einfühlsam und fürsorglich um das Baby zu kümmern, werden sich hingegen unangenehme Empfindungen einstellen. Angenehmes lässt uns mit Annäherung reagieren, Unangenehmes mit Rückzug.
Wir wollen gliebt werden für unser Sein
Dieser sehr frühen Prägung darüber, ob ein Baby willkommen und geliebt ist, folgen meist zahlreiche weitere. So wird ein Kind geschimpft, wenn es wild herumläuft und gelobt, wenn es sich still mit seinen Spielsachen beschäftigt. Wut darf nicht gezeigt werden, Freundlichkeit ist erwünscht. Bemerkungen wie „Du singst schrecklich.“ sind beschämend und töten jegliche Begeisterung. Von außen wird vermittelt: „Wenn ich so bin, bin ich okay. Wenn ich mich anders verhalte, bin ich nicht okay.“ Da kleine Kinder alles auf sich beziehen, formt sich nach und nach ein Bild von einem Selbst, das mehr ein Mix aus beliebigen Vorstellungen und Erwartungshaltungen anderer ist, als ein wahres Selbst. Die fatale Folge ist, dass das kleine Wesen lernt, dass es nicht geliebt wird für „Wer ich bin.“ sondern für „Wie ich bin.“, denn die Liebe ist geknüpft an Bedingungen. So formen sich nach und nach Glaubenssätze wie „Ich kann nicht singen.“, „Ich darf nicht wütend sein.“ oder gar „Ich bin nicht liebenswert.“´, die es zu entlarven gilt, denn sie sind Zeugnis eines „falschen“ Selbst. Es handelt sich um eine Illusion und nicht die Realität.

Bewertung beeinflusst unser Verhalten
Das Selbstbild und all unsere Erfahrungen bilden eine Art Filter, durch den wir die Welt betrachten. Dieser Filter ist naturgemäß immer subjektiv, da es keine zwei gleichen Menschen bzw. Lebensgeschichten gibt. Sieht der eine ein Geschenk als eine freundliche Geste, sieht der andere es vielleicht als Bestechungsversuch. Wir bewerten die Welt aus unserer subjektiven Sicht. Einem Reiz aus dem Außen – in diesem Fall das Geschenk – folgt eine Interpretation. Diese wiederum löst ein Gefühl aus, das wie schon beschrieben angenehm oder unangenehm sein kann und entsprechend das Verhalten über Annäherung oder Rückzug lenkt. Bei Freude über das Geschenk bedeutet das z.B. die Dankbarkeit auszudrücken und ein Gespräch zu beginnen; im Falle des Misstrauens über den Hintergrund des Geschenks geht das Verhalten eher in Richtung eines Zurückweichens und Abblockens des Kontakts.
Wohlgemerkt: Es handelt sich nach wie vor um ein und dasselbe Geschenk. Die Interpretation gefüttert aus vergangenen Erfahrungen und Selbstbild ist es, die schlussendlich das Verhalten verändert. Durchaus möglich, dass es in der Vergangenheit unangenehme Erfahrungen mit ähnlichen Situationen gab. Vielleicht gab es in der Kindheit Schokolade nur, wenn bestimmte Aufgaben im Haushalt erledigt wurden, die man nicht gern ausgeführt hat. Diese alten Geschichten beeinflussen allerdings das Geschehen im gegenwärtigen Moment, in dem vollkommen bedingungslos ein Geschenk angeboten wird.

Der Raum, in dem die Freiheit liegt
„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.”, hat Viktor Frankl einst gesagt. Wenn wir es schaffen, auf einen Reiz nicht automatisch zu reagieren, sondern uns diesen Raum zu eröffnen, eine neue Erfahrung zu machen, dann liegt darin Befreiung. Dann können wir die Beschränkungen von Glaubenssätzen, Prägungen und Mustern sprengen. Aus dem falschen Glaubenssatz „Ich kann nicht singen.“ und einem damit verbundenen Widerstand zu singen, kann sich die Tür öffnen es auszuprobieren um die Erfahrung zu machen, wie wohlklingend die eigene Stimme ist – wenngleich auch noch ungeübt – und wie viel Spaß es macht, sich auszudrücken. Und nach und nach beginnt der Glaubenssatz zu bröckeln und man muss sein Selbstbild überarbeiten. Und so ist es mit vielerlei Vorstellungen, die wir haben, sei es über uns selbst („Ich muss perfekt sein.“), über die Beziehung zu anderen („Ich muss es dir recht machen, damit du mich liebst.“) oder generellen Ansichten zum Leben („Ohne Fleiß kein Preis.“).
Trauma verletzt das Selbst
„Das zutiefst Eigene eines Menschen sind seine Gefühle und Bedürfnisse.“, schreibt der Psychoanalytiker Arno Gruen. Häufig sind es traumatisierende Erfahrungen in Entwicklung und Bindung, die den Zugang zur eigenen Innenwelt und damit zum wahren Selbst behindern. Wenn man einst als Kind erlebt hat, dass man seine Wut gezeigt hat und sich daraufhin die Eltern abgewandt haben oder man aufs Zimmer geschickt wurde – kurzum, der Kontakt abgebrochen ist, was sehr verängstigend ist – dann fällt es später nicht so leicht, seine Wut auszudrücken. Lieber bleibt man angepasst, sagt nichts und drückt sie weg. Der Arzt Dr. Gabor Maté sagt dazu: „Trauma zwingt uns, verletzte und unliebsame Bestandteile unserer Psyche zu unterdrücken, es zerteilt unser Selbst in Bruchstücke.“
Aus Kinderaugen war es eine sehr bedrohliche Situation. Heute aus Erwachsenensicht können wir es wagen, unsere Wutkraft zu nutzen, um Grenzen klar zu setzen. Darin zeigt sich, dass wenn wir diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten, wir erkennen können, dass wir anders handeln können, als wir es gewöhnt sind. Die neuen Erfahrungen, in denen wir unsere bislang unterdrückten Gefühle und Bedürfnisse leben wiederum sind es, die uns dabei helfen, alles zu leben. Wir fühlen uns ganz, leben unser wahres Selbst.
LITERATUR
Der Verrat am Selbst: Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau
Arno Gruen, 1986
Fühl dich ganz: Was wir gewinnen, wenn wir unsere Gefühle verstehen und zulassen
Lukas Klaschinski, 2024
Leben mit der Polyvagal-Theorie: In Sicherheit verankert
Deb Dana, 2023
Vom Mythos des Normalen: Wie unsere Gesellschaft uns krank macht und traumatisiert – Neue Wege zur Heilung
Dr. Gabor Maté, 2023
Wer wir sind: Wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben – Alles, was Sie über Psychologie wissen sollten
Stefanie Stahl, 2023

Neugierig?
Du suchst einen Weg, dich sicher und verbunden zu fühlen? Du möchtest deine volle Lebenskraft spüren und in Kontakt sein mit deiner inneren Weisheit, um deinen Lebensträumen zu folgen? Ich begleite dich gerne in Einzelsitzungen, mit Ritualen oder fotografisch, sodass du dir selbst begegnen kannst und deine Lebensenergie harmonisch im Fluss ist.
Share this story